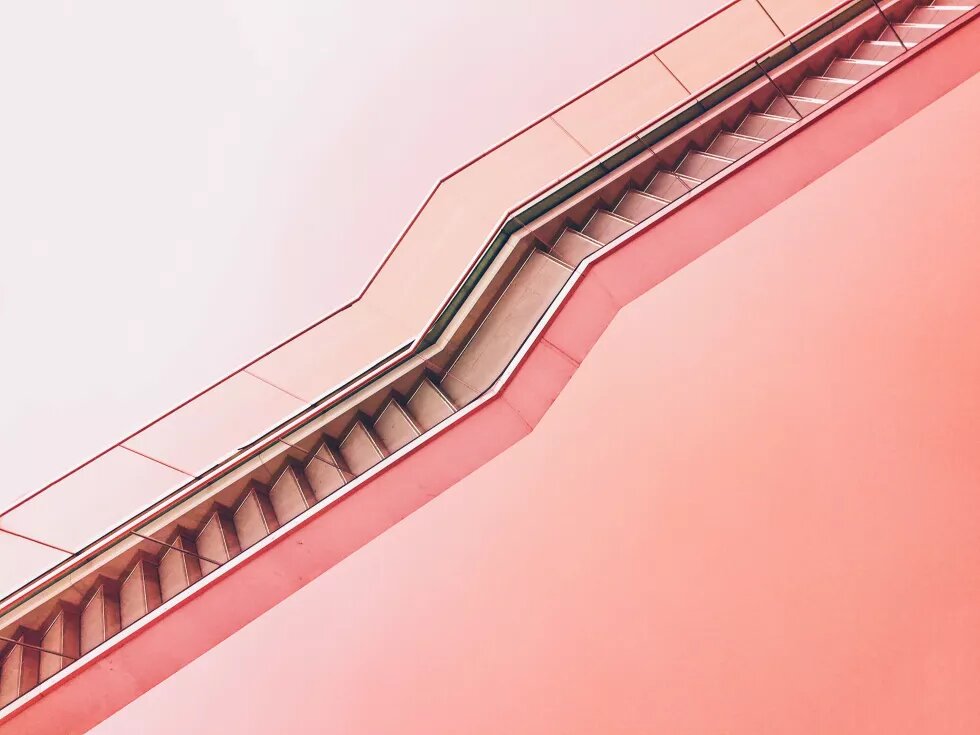
Wer Kimberlé Crenshaw sagt, meint Intersektionalität – und umgekehrt. Das ist ungefähr so wie Einstein und die Relativitätstheorie oder wie Newton und das Gesetz der Gravitation. Zwei Seiten derselben Medaille. Untrennbar. Und von einigem Gewicht. Schließlich hat das Konzept der Intersektionalität wie kaum ein anderes in den vergangenen Jahren weit über das feministische Denken hinaus unser Verständnis der Komplexität von Diskriminierung und der vielfältigen, oft widersprüchlichen Verflechtungen und Überlagerungen von Herrschaftsstrukturen geprägt. Dass wir seit der UN-Weltkonferenz gegen Rassismus im Jahr 2001 in Südafrika von „Mehrfachdiskriminierung“ sprechen, ist nur einer von vielen Belegen hierfür. Intersektionalität antwortet auf die große Herausforderung, dass die Lebensverhältnisse und Subjektivitäten aller Geschlechter nur begreift, wer sich analytisch nicht auf Geschlecht beziehungsweise Gender beschränkt, jene Verhältnisse aber ebenso wenig ohne ein umfassendes Verständnis von Geschlechterverhältnissen und Gender zu verstehen sind. Geschlechterverhältnisse ebenso wie rassifizierte, ethnifizierte oder Klassenverhältnisse kollaborieren mit anderen Dimensionen sozialer Teilung, sie sind durch diese vermittelt und gebrochen, und sie vermitteln und brechen diese. „‚Rasse‘“, so hat es Judith Butler einmal formuliert, wird „in der Modalität von Sexualität“ und „das soziale Geschlecht in der Modalität von ‚Rasse‘ gelebt“. Marginalisierungen treten also nicht nacheinander oder nebeneinander auf, sie amalgamieren, überlagern sich, treten im Gewand der jeweils anderen auf. Intersektionalität, so Kimberlé Crenshaw, bedeutet, dass ich nicht erst von Rassismus und dann von Sexismus überfahren werde, sondern von beidem gleichzeitig. Wie gleichermaßen aufregend und herausfordernd für das Denken der Verflechtung von Herrschaftsverhältnissen das noch immer ist, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie lange wir schon versuchen, so zu denken. Denn das reicht weit über Crenshaws Bild der sich überkreuzenden Achsen zurück. In ihrer Biographie A Colored Woman in a White World aus dem Jahr 1940 hatte die afro-amerikanische Journalistin, Bürgerrechtsaktivistin, Feministin und Vorkämpferin für das allgemeine Wahlrecht, Mary Church Terell, die 1904 auf dem Internationalen Frauenkongress in Berlin zusammen mit Susan B. Anthony die US-amerikanischen Frauenrechtsvereine vertrat und dort die einzige Schwarze Rednerin war, ihre eigene Geschichte beschrieben als die einer „colored woman living in a white world. It cannot possibly be like a story written by a white woman. A white woman has only one handicap to overcome – that of sex. I have two – both sex and race.“ Und noch einmal ein halbes Jahrhundert früher, 1892, hatte die noch in der Versklavung geborene afro-amerikanische Autorin, Soziologin, Mathematikerin, Pädagogin und Aktivistin Anna J. Cooper, die 1925, im Alter von 65 Jahren, als erst vierte Schwarze Frau in der Geschichte der USA einen Doktortitel in Philosophie erwarb, erklärt: „The colored woman of to-day occupies a unique position in this country. She is confronted by both a woman question and a race problem, and is as yet an unknown or anunacknowledged factor in both.“
Mary Church Terrel und Anna J. Cooper sind – wenigstens in deutschsprachigen akademischen wie aktivistischen Zusammenhängen – selbst noch zu entdeckende Unbekannte, doch im Konzept der Intersektionalität lebt ihr Denken unwissentlich fort. 100 Jahre nach Anna Coopers Überlegungen sollte Kimberlé Crenshaw indirekt an diese Figur der „unknown“ bzw. „unacknowledged“ Position der Schwarzen Frau* anknüpfen, als sie von „intersectional invisibility“, also der Unsichtbarkeit intersektional strukturierter Positionen und Verhältnisse sprach. Crenshaw meinte damit eine systematische Überblendung, wodurch sowohl die geschlechtsbezogenen Aspekte rassistischer Diskriminierung wie die rassistischen Implikationen geschlechtsbezogener Diskriminierung unsichtbar gemacht würden. An Mary Church Terrell oder Anna J. Cooper zu erinnern ist deshalb mehr als bloße Nostalgie, es stellt vielmehr eine aktive Intervention dar in eine in der Diskussion um Intersektionalität oft feststellbare eigentümliche Geschichtsvergessenheit, die wiederum selbst aktiv zur Unsichtbarmachung der reichen und vielfältigen Geschichte feministischen Denkens und feministischen Aktivismus’ zur Verflechtung von Sexismus und Rassismus beiträgt. Und das gilt vielleicht mehr noch als für Crenshaw selbst für die Geschichte der deutschsprachigen Rezeption ihrer Arbeiten. Denn lange vor der transatlantischen Reise und der Ankunft der Metapher der Kreuzung von Unterwerfungsverhältnissen in den 1990er Jahren wurde auch hier in feministischen, lesbisch-feministischen und frauenbewegten Zusammenhängen intensiv gerungen um die Frage, wie Sexismus, Rassismus und klassenbasierte Herrschaftsverhältnisse miteinander verknüpft sind.
Ich will dafür nur ein Beispiel nennen: Im Aufruf zum ersten gemeinsamen Frauenkongress ausländischer und deutscher Frauen, der im März 1984 in Frankfurt am Main stattfand, beschreiben die Frauen* – sich damals selbst „ausländisch“ nennend – ihre Lage so: „Ausländerin zu sein, d. h. direkte Entmündigung und Unterdrückung 34 in dreifacher Hinsicht: als Ausländerin, als Lohnabhängige und als Frau“. „Höchste Zeit“ sei es, aus der „Isolation und der Vereinsamung im täglichen Kampf gegen die Unterdrückung durch die Gesetzgebung, durch die Männer, durch die Verhältnisse am Arbeitsplatz“ herauszutreten, das „Schweigen zu brechen im Austausch untereinander, aber auch im Austausch mit deutschen Frauen“. Die Idee zum Kongress war entstanden, nachdem die Frauen* auf dem „Tribunal gegen Ausländerfeindlichkeit und Menschenrechtsverletzungen“, das im Jahr zuvor stattgefunden hatte, wieder einmal die Erfahrung gemacht hatten, „daß die ‚Frauenfrage‘ als Randfrage“ behandelt wurde, für die eine Diskussion in einer Arbeitsgruppe ausreiche, wie sie in der Dokumentation des Kongresses schreiben. Auf dem Kongress selbst, der unter dem Motto „Sind wir uns denn so fremd?“ stand und an dem mehr als 1000 Frauen* teilnahmen, wurde in mehreren Vorträgen und Arbeitsgruppen das Verhältnis von Rassismus und Sexismus intensiv untersucht und diskutiert. Noch heute erinnere ich lebhaft die leidenschaftlichen Diskussionen, die intensiven Versuche, einander verständlich zu werden, den unbändigen Willen, etwas zu bewegen.
Auf diesem „1. gemeinsamen Kongress ausländischer und deutscher Frauen“ wurde lebendig, was die Sozialwissenschaftlerin Gudrun Axeli Knapp die „heiße epistemische Kultur“ des Feminismus genannt hat: dass Feminist* innen und frauenbewegte Frauen* – nicht immer das Selbe – nah an den Bedingungen und Konstellationen ihrer spezifischen Leben und Erfahrungen feministische – ja: auch intersektionale – Theorie produzieren. Es sind Ereignisse wie diese – und viele mehr ließen sich nennen –, die Teil einer wesentlich noch zu erzählenden feministischen Genealogie intersektionaler Wissensproduktion sind. Und die Arbeit der „ausländischen Frauen“ des Frankfurter Kongresses, ihre Bestrebungen, die ihnen widerfahrene 35 „Entmündigung und Unterdrückung in dreifacher Hinsicht“ zu verstehen und zu politisieren, sind Teil dieser Geschichte. Es ist die Geschichte einer Wissensproduktion die gerade da ansetzt, wo die oft in der Verkündung steckenbleibenden Intersektionalitätsprogrammatiken Halt machen: an der Erforschung der je konkreten und letztlich zufälligen Konstellationen von Dominanz und Unterwerfung, Ermächtigung und Beschränkung. Intersektional zu denken und intersektional Politik zu machen heißt daher auch, der Unsichtbarmachung dieser Geschichte entgegen zu wirken.


