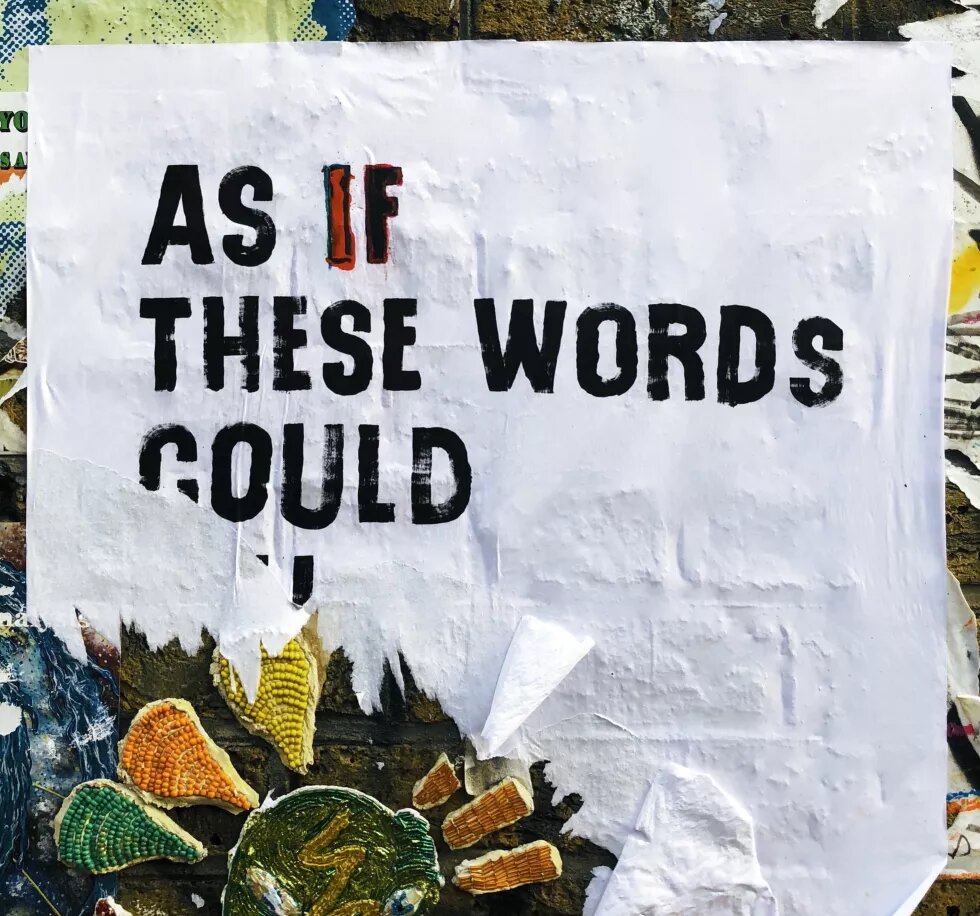
Die Wahlen in drei ostdeutschen Bundesländern sind vorbei und es stellt sich etwas ein, das mich schon länger begleitet: Diskurs-Burnout. Das ist die Folge eines ewigen inneren Streits: Ich will nicht, dass die da einfach so ihren Hass in die Welt pusten. Aber natürlich macht es nicht den geringsten Spaß, zu debattieren, ob man jetzt wieder gekränkten Menschen besser beim Hetzen zuhören muss. Soll ich mir schon wieder zurechtlegen, warum Björn Höcke nicht bürgerlich ist? Ein ähnlich lähmendes Gefühl macht sich breit, wenn jemand wieder über "Sprechverbote" und die "Diktatur der political correctness" lamentiert oder findet, dass Menschen nicht zum Verzicht für den Klimaschutz gedrängt werden dürfen.
Ich hielte es lieber mit Bartleby: “I'd prefer not to“. Denkt doch, was Ihr wollt, ich mach nicht mit. Streik. Ausstieg. Stille. Herrlich.
Aber dann kommt der nächste Tag und der nächste Spruch, und man kann gar nicht so viel weghören wie gequatscht wird. Was jetzt? Ich habe gerade Marshall Rosenbergs "Gewaltfreie Kommunikation" nochmal gelesen. Daraus habe ich fünf Sätze mitgenommen, die mich insgesamt irgendwie ruhiger gemacht haben.
„Gewaltfreie Kommunikation“ und meine innere Opposition
1. Ich lasse mal gerade das Urteilen sein. Also das Aufspüren und Dingfest-Machen der schrecklichen Anderen: Da ist ein Rechter, den man nicht Nazi nennen darf. Oder gerade doch nennen muss. Dort scheint sich ein Sexist zu äußern und hier dieser Antisemit, kann man den nicht gleich einlochen? Auf jeden Fall sind die minderbemittelt. Tricky daran ist: Wenn ich die ordentlich verachte, wozu führt das? Sie fühlen sich verachtet und hassen noch mehr. Ich muss noch mehr verurteilen. Kreislauf, Leerlauf, Burnout. Also lass ich es einfach mal bleiben, das Urteilen.
Natürlich kommt jetzt gleich meine innere Opposition: "Aber, aber, aber, man muss doch, man kann denen doch nicht das Feld überlassen, Widerstand..." Ja, ja, aber mal langsam. Wenn ich mal eine Weile Pause mache, die anderen machen sicher für mich weiter.
2. Das sind Menschen wie ich. Klingt so platt wie verharmlosend und - bin ich eigentlich Jesus oder was? Rosenberg sagt: Hinter ihrem Getöne, Geschrei und Gehasse steckt etwas, das ich ohne weiteres verstehen kann, wenn ich will. Bedürfnisse, die alle Menschen haben: Anerkennung als Person. Sicherheit. Körperliche Unversehrtheit. Eine Welt, in der ich mich zurecht finde. Gerechtigkeit. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Gehört und gesehen werden. Materielle Sicherheit. Und so weiter.
Marshall Rosenberg ist ein 60er Jahre-Hippie-Psychologe und hat Jahrzehnte lang in zahllosen Konflikten vermittelt, zwischen Israelis und Palästinensern, Männern und Frauen, Schwarzen und Weißen, verfeindeten Gangs und, und, und. Seine Erfahrung: Wenn man Gefühle anerkennt und die Bedürfnisse, die sich darin ausdrücken, ernst nimmt, dann kann die Energie dieser Gefühle in eine der Bedürfnisbefriedigung umgelenkt werden. Er fragt die Oberhasser also so lange, bis er zu den ungehörten Bedürfnissen vorgedrungen ist.
Innere Opposition: "Ach nee, jetzt doch wieder gekränkten Typen beim Hetzen zuhören? Naziversteher*in werden oder was? Geht's noch?" Langsam, langsam.
3. Deine Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Rosenbergs Theorie: Erst diejenige Person, deren Bedürfnisse ganz und gar wahrgenommen wurden, ist wieder in der Lage, auch die Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen. Andere Leute haben auch das Bedürfnis nach Sicherheit, Anerkennung, Gerechtigkeit, Übersichtlichkeit, Zugehörigkeit etc. Nicht nur der Nazi und der Sexist haben dieses Problem: Die Frauen haben es, sie wollen nicht sexistisch behandelt werden, Black People und People of Color haben es, Flüchtlinge, Alte, Kranke, Behinderte, LGBTI, alle. Und dann fragt er schlicht, aber schon irgendwie entwaffnend: Wie können wir unserer beider Bedürfnisse gerecht werden, ohne dass eines geleugnet wird?
4. Nicht das Gefühl, sondern das Bedürfnis ist wichtig. Das heißt für einen Diskurs mit Antisemit*innen, Sexist*innen, Nazis und anderen also gerade nicht, dass man nun auf deren Hassforderungen nach weiterer Ausgrenzung und der Verweigerung von Rechten für andere eingehen muss. Sondern dass man danach sucht, was dem dahinterliegenden Bedürfnis nach Sicherheit oder Anerkennung dient.
Alle haben grundlegende Bedürfnisse
Das ist dann zum Beispiel natürlich nicht, dass man die Frauenrechte lieber zurückdrängt, weil die Jungs das sonst nicht ertragen. Oder geflüchteten Menschen weitere Rechte nimmt, damit die Nazis und Spießer*innen zufrieden sind. Es geht ja um die Bedürfnisse von allen. Es heißt eher, dass man einem frustrierten Mann die Möglichkeit der Anerkennung auf einem anderen Gebiet als seinem unfruchtbaren Sexismus schafft. Oder, jetzt mal ganz weit ausgeholt, die soziale Sicherheit für alle verbessert, anstatt Flüchtlingen Leistungen zu kürzen.
Rosenberg hat die Erfahrung gemacht, dass beide Seiten ungeahnte Kreativität entfalten, wenn ihre grundlegenden Bedürfnisse (unter dem Geschrei) erst einmal voll und ganz gesehen und gehört wurden.
Innere Opposition: „Hä? Hast Du Dir mal diese Schreihälse angeguckt? Wie soll man unter dem Gehasse und dem Gefühlswust überhaupt so ein Bedürfnis rauspulen? Was ist denn überhaupt ein Bedürfnis?“ Antwort: Ja, das ist eine hohe Kunst, die man erlernen und üben muss. Auch Rosenberg ist übrigens unzählige Male gescheitert, an den Gefühlsmauern der anderen, an seinen eigenen, es ist halt ein Experiment.
5. Was brauche ich denn gerade? Und wenn dann die innere Opposition nun endgültig in Hohngelächter ausbricht? „Das ist ja wohl das Anstrengendste, was man überhaupt machen kann. Ich therapier doch keine Nazis! Bin doch selbst gerade vor dem Burnout!“ Tja, bevor man anderen Empathie geben kann, braucht man Empathie für sich selbst. Das ist für Rosenberg die grundlegendste Lektion. Was brauch ich denn gerade? Eine Pause? Urlaub? Ein Yoga-Workshop, ein Bier oder ein gutes Essen?
Ich zum Beispiel stelle mir das erstmal einfach nur vor. Ich muss es ja gar nicht machen. Ich stelle mir vor, wie ich vor einem Rechten stehe und frage und frage, bis er sein Bedürfnis nach Sicherheit und Übersichtlichkeit äußern kann. Und wie ich dann sage: "Und ich, ich habe auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und Übersichtlichkeit. Ich will um Beispiel nicht, dass Menschen bedroht werden. Was machen wir denn jetzt, um unserem gemeinsamen Bedürfnis gerecht zu werden?"
Und dann bekomme ich Lust, irgendwann mal auszuprobieren, wie weit man wohl damit kommt, mit dieser so utopisch hippiemäßig klingenden gewaltfreien Kommunikation. Natürlich will ich das heute nicht machen und morgen auch nicht. Und bestimmt nicht als erstes mit einem Nazi oder Ähnlichem. Aber vielleicht mal mit dem nächsten mittelmäßigen Sexisten, der um die Ecke kommt...
Literatur: Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie Kommunikation. Eine Sprache des Lebens. Paderborn 1999


